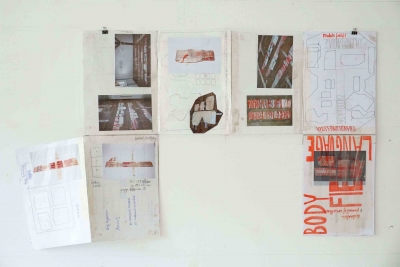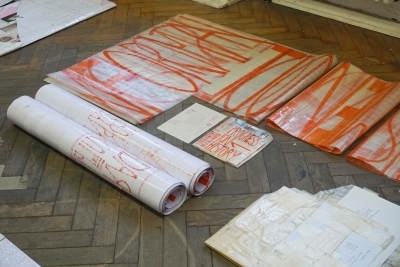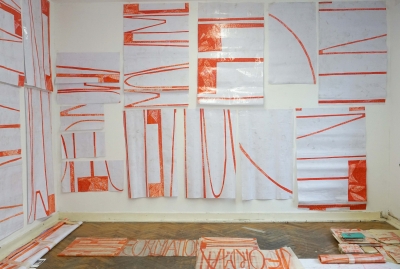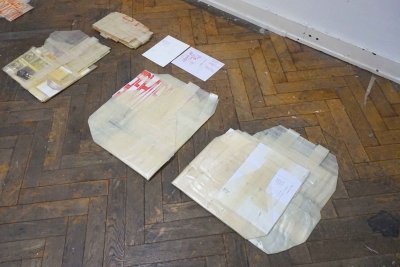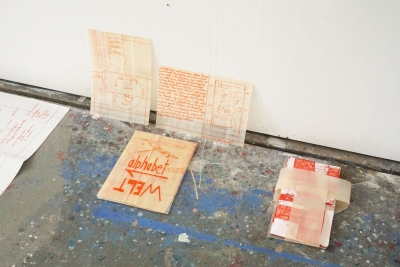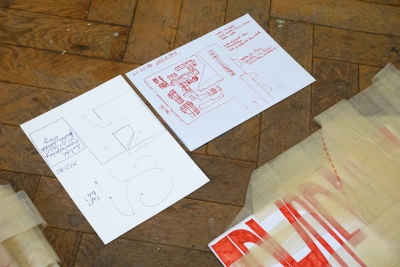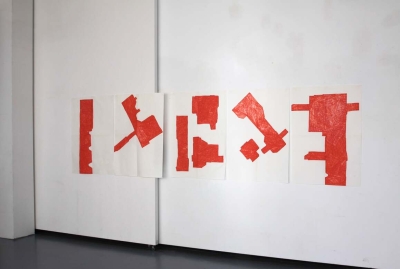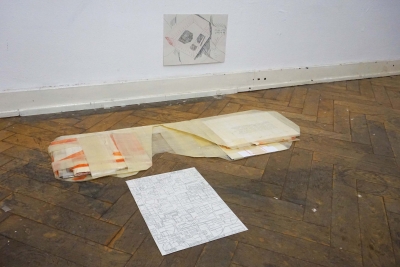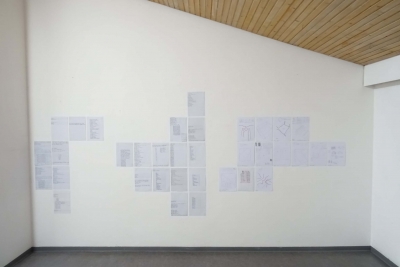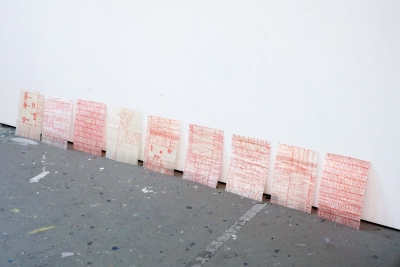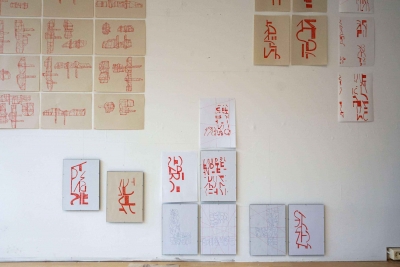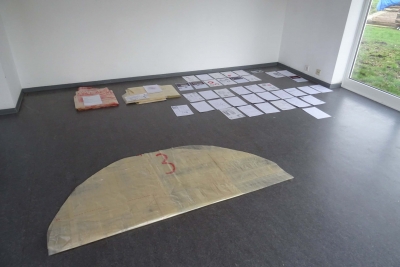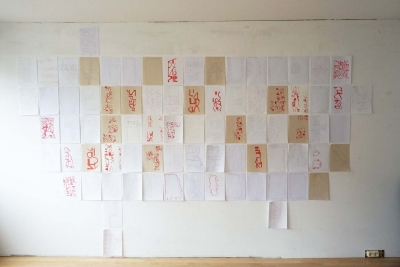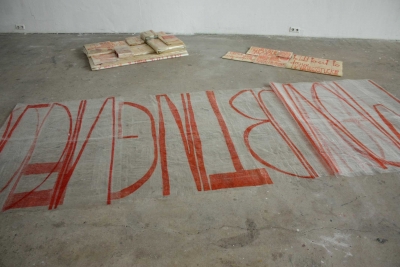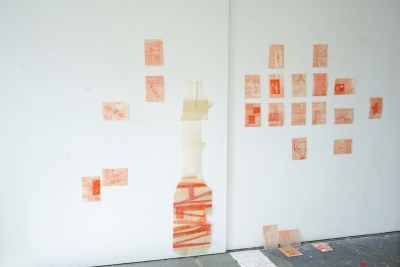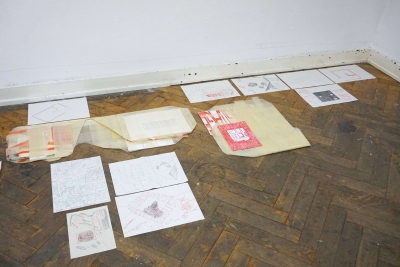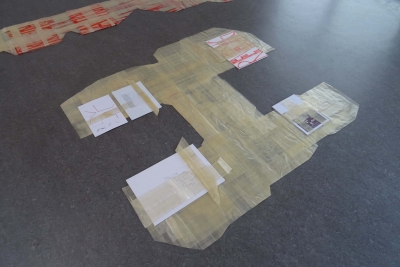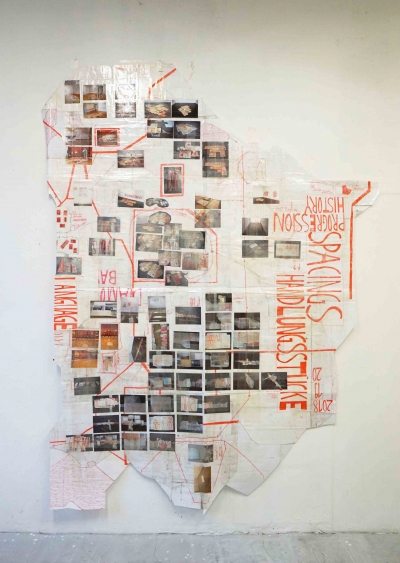- - 2025 Forum für Kunst und Architektur Essen, casual collaborations and the conditions of belonging
- - 2025 91.Herbstausstellung, Kunstverein Hannover and städtische Galerie Kubus
- - 2025 Räume und Felder, Künstlerzeche Unser Fritz 2/3, Herne
- - 2025 b o d y s c o r e s (repositioned), Allgemeiner Konsumverein Braunschweig
- - 2024 Paula Modersohn-Becker Kunstpreis, Große Kunstschau Worpswede
- - 2024 Raum als Ort, Künstlerhaus Dortmund
- - 2024 Speaking Soil, Collection Philara
- - 2024 BODY DECLINATION, städtische Galerie im Park Viersen
- - 2023 RESIDENCE III, Syker Vorwerk
- - 2023 90.Herbstausstellung, Kunstverein Hannover
- - 2023 alphabet (Teile für Welt), Neuer Kunstverein Wuppertal
- - 2023 Drawing Allover, Kubus kooperativ, städtische Galerie Kubus, Hannover
- - 2022 Kunstgenerator Viersen, Auswahlausstellung, städtische Galerie im Park Viersen
- - 2022 Kurt Schwitters in der Kunst von Heute, Kunsthalle Wilhelmshaven
- - 2022 BASIC SPLITS, cubus-Kunsthalle Duisburg
- - 2022 placement and positioning, Künstler,-und Atelierhaus Duisburg
- - 2021 art prize Junger Westen 2021, Kunsthalle Recklinghausen
- - 2021 language fields (deconstructed, fragmented), Ludwigsturm Duisburg
- - 2020 Meeting in language, städtische Galerie Delmenhorst
- - 2021 Sprache sprechen Raum denken, SG1-Duisburg
- - 2020 Kubus kooperativ "editions", städtische Galerie Kubus Hannover
- - 2019 BOX, Neuer Kunstverein Wuppertal
- - 2019 mobile bodies, Künstlerstätte Stuhr-Heiligenrode
- - 2019 Preis der Nordwestkunst, Kunsthalle Wilhelmshaven
- - 2018 Meisterschüler 2018, städtisches Museum Braunschweig
- - 2017 DIAMOND FIELD PART I, Artmax Braunschweig

- 2017 DIAMOND FIELD PART I, Artmax Braunschweig

field view

on field view, center position
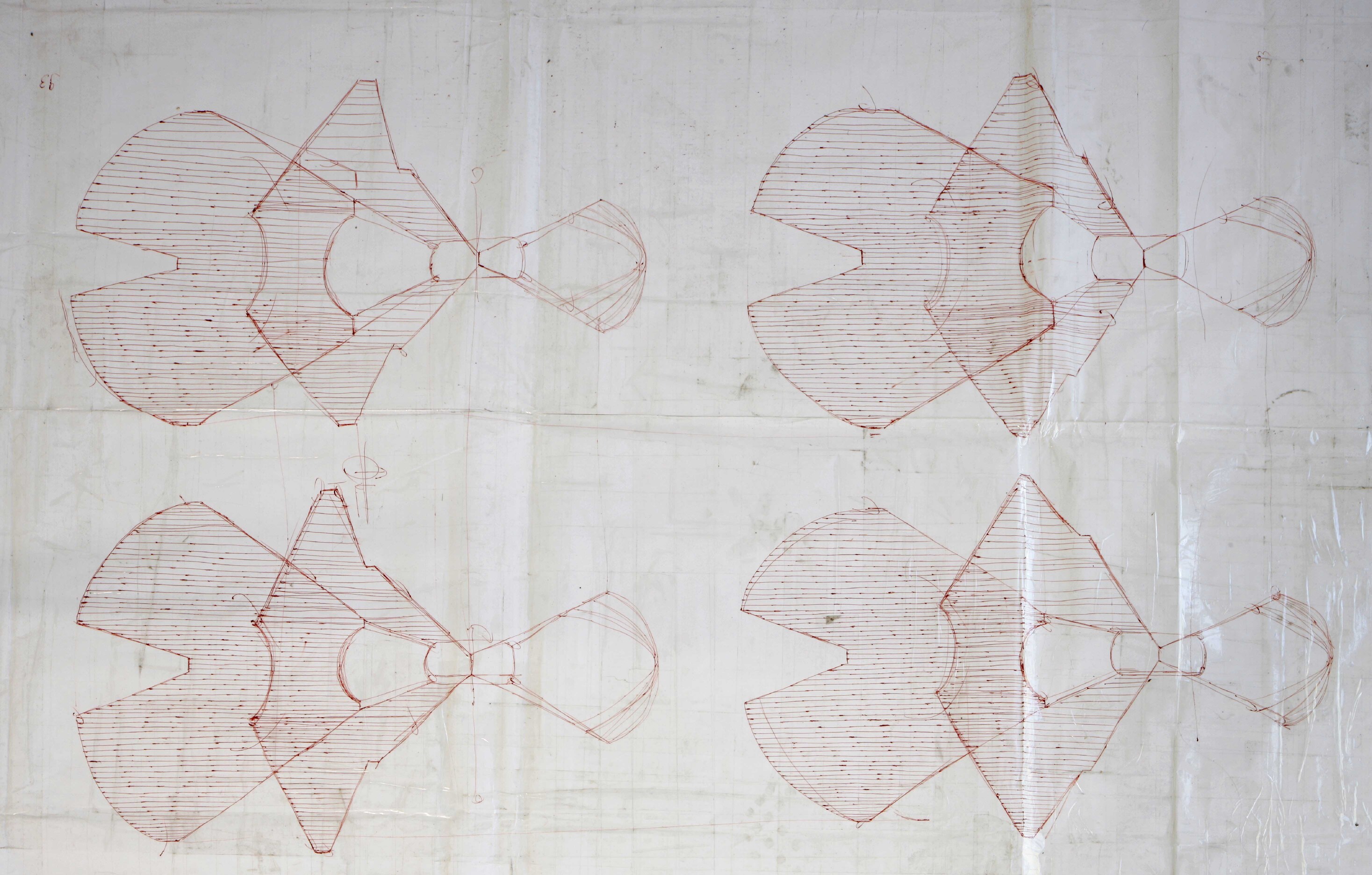
field drawing nr.93
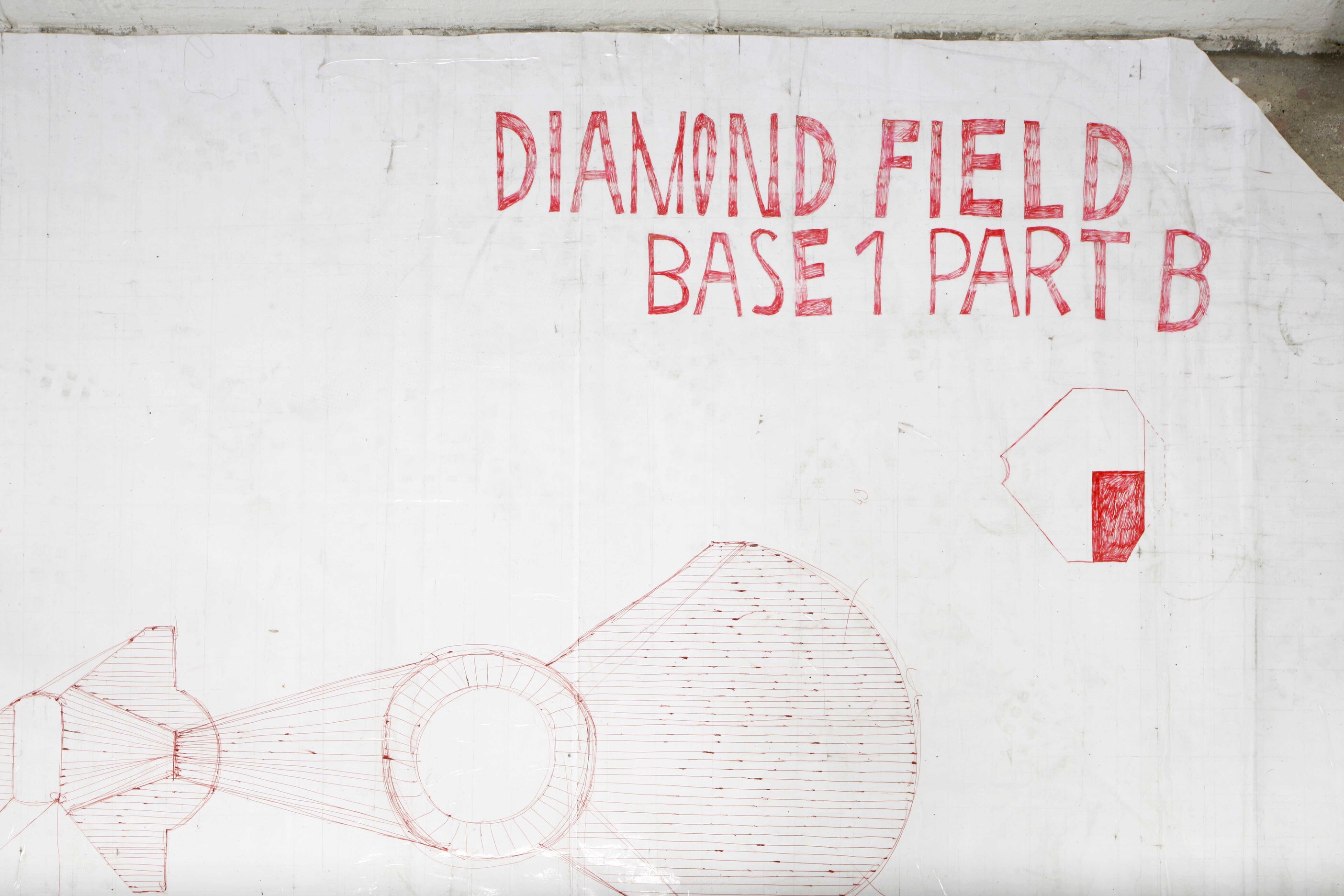
field legend, writing and drawing

field detail, base position

on field view 2
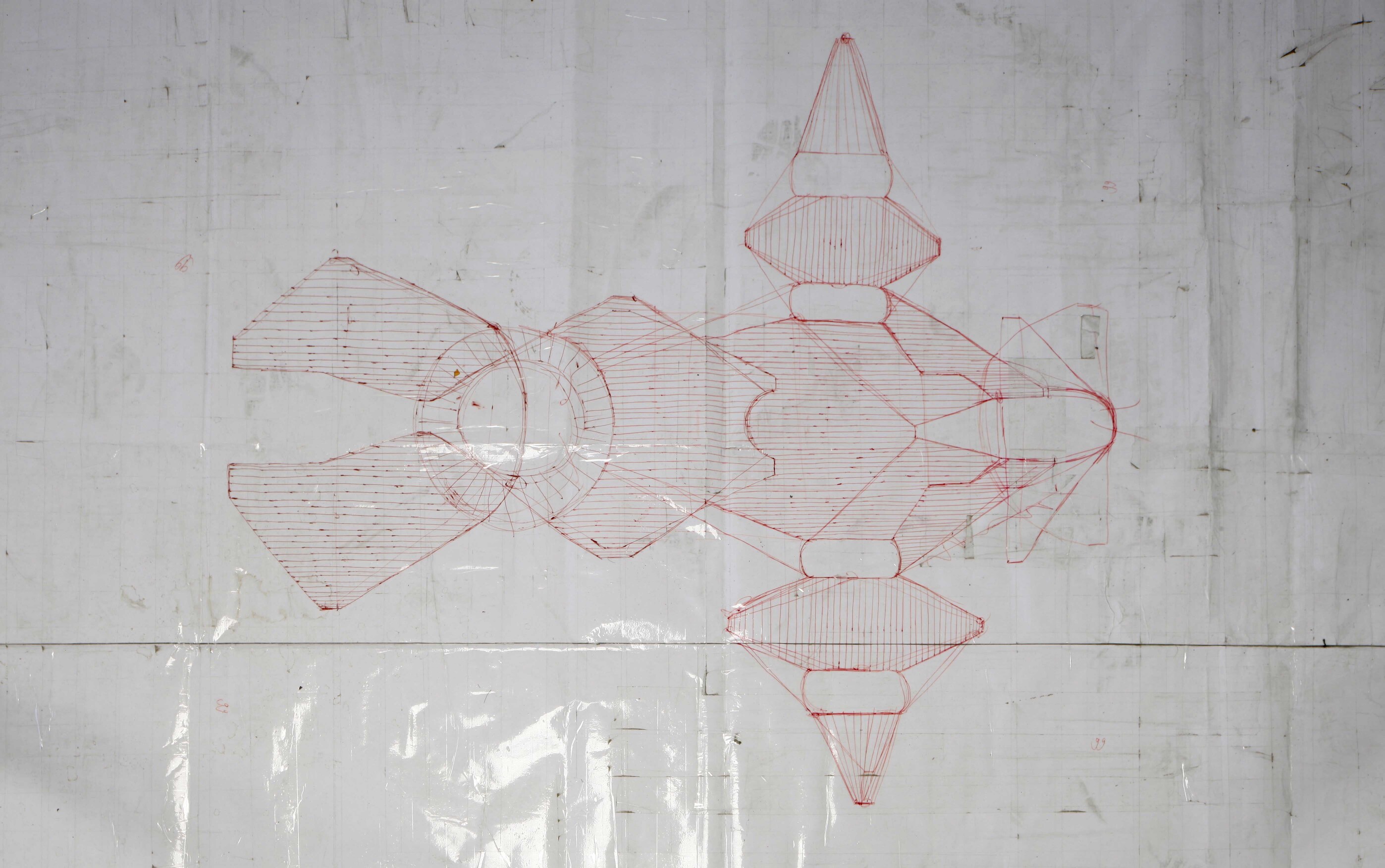
field drawing

installation view
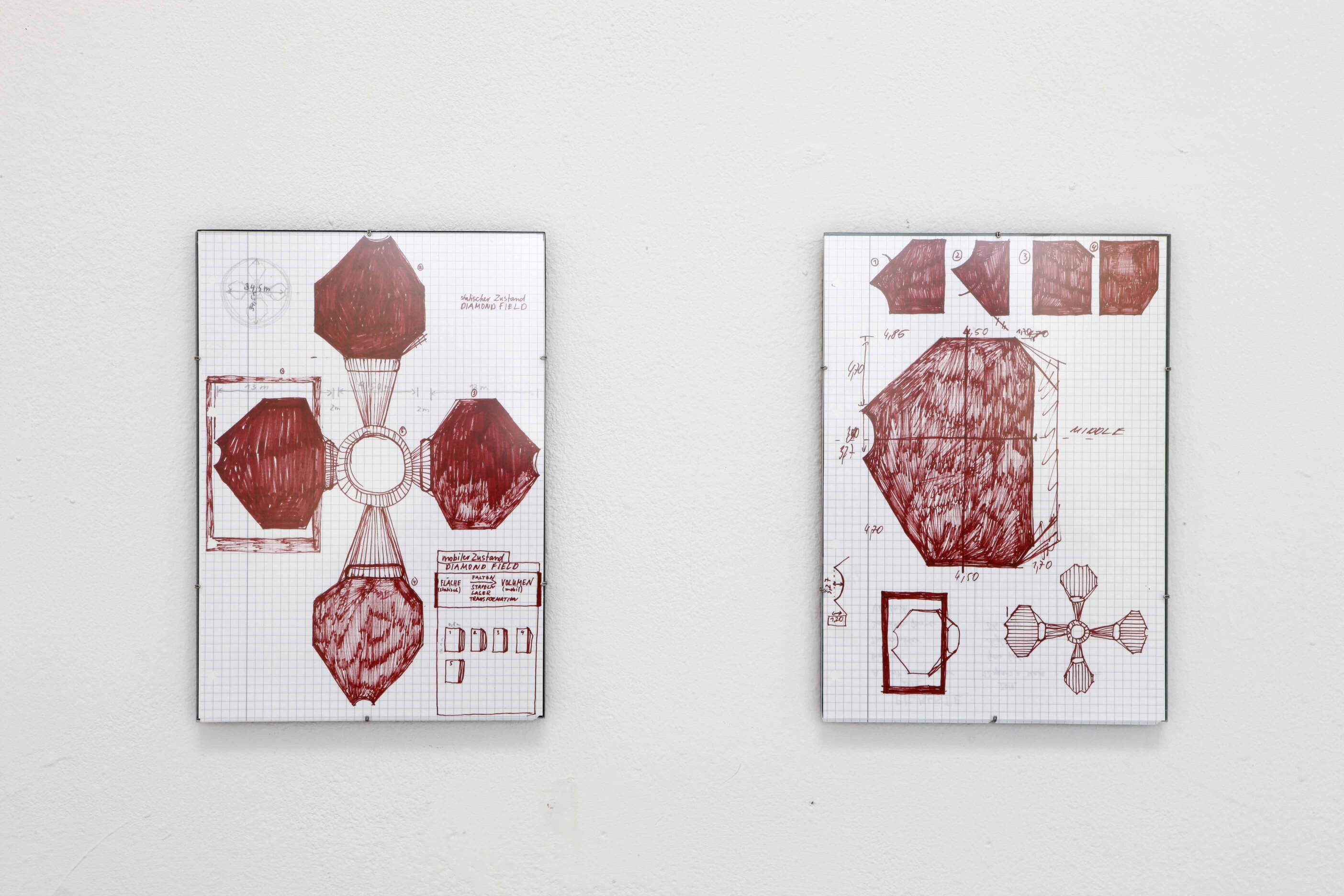
field drawings, concepts of the field and position sketches, each 21x29,7cm, framed
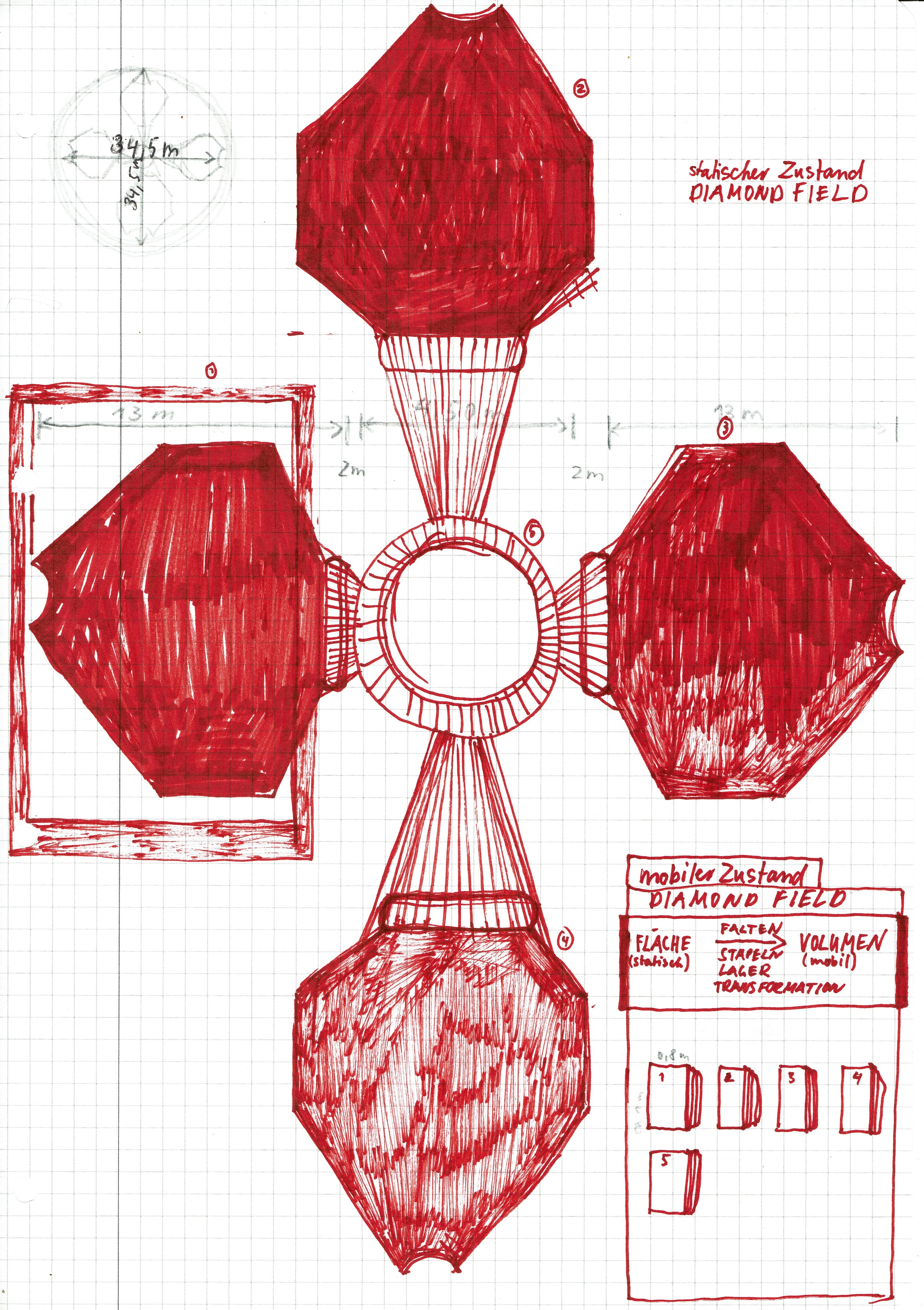
field drawig, 21x29,7cm
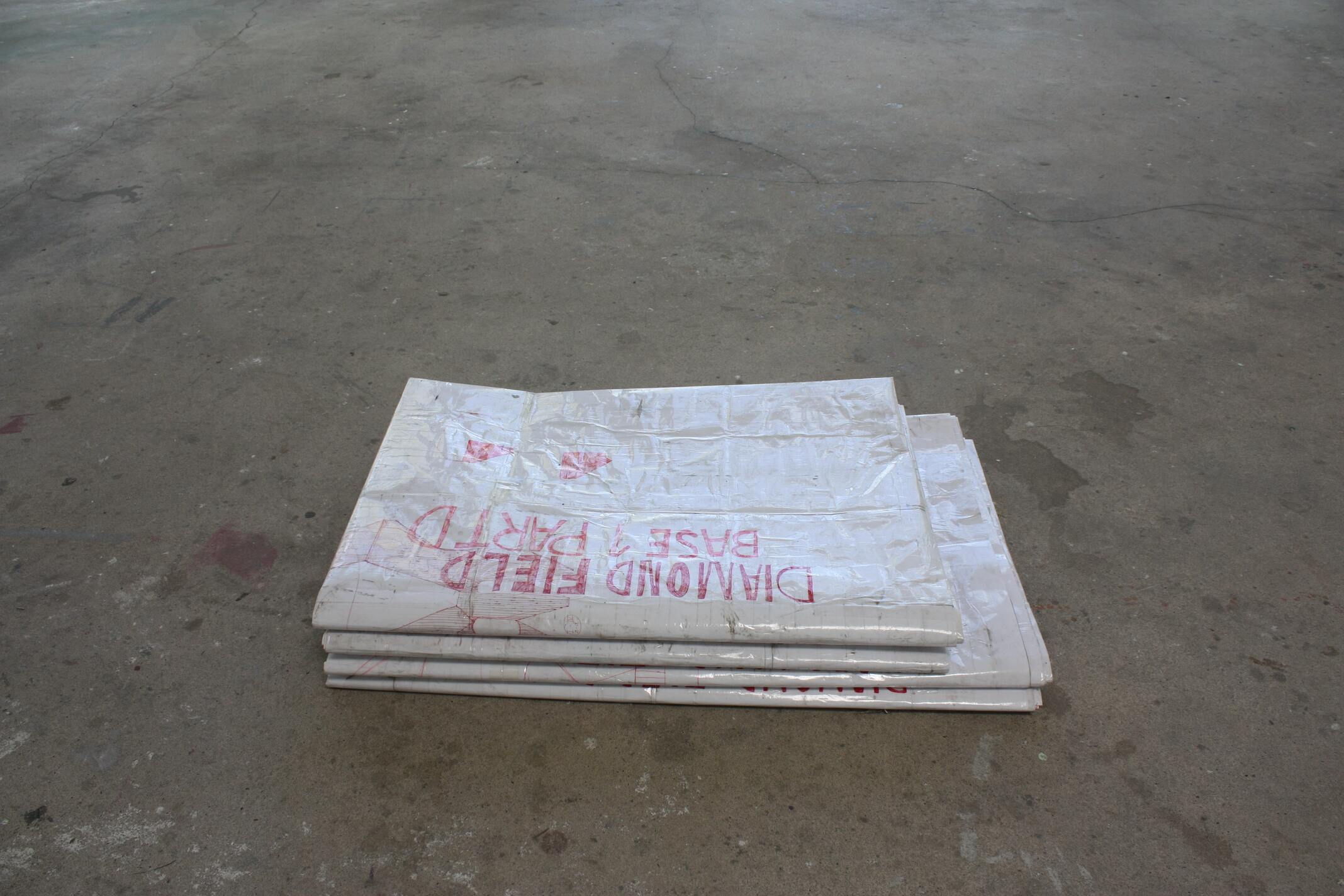
DIAMOND FIELD (PART I), folded and stapled, mobile state of the field
Diamond FIeld Part I /side 1 (static and mobile state)
foldable four part system, double sided
paper, pvc, ballpoint pen
89qm
Kraftfelder
Andreas Bee
Vor beinahe 40 Jahren formulierte Rupert Sheldrake eine Hypothese, die zunächst für einiges Aufsehen sorgte
und heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Der britische Biochemiker und Zellbiologen beschäftigte
sich mit der Frage der Entstehung der Formen in der Natur. Nach seiner Auffassung sind es sogenannte
morphogenetischen Felder, die die Entwicklung von Strukturen und Formbildungen beeinflussen. Jede Gestalt
und jede Art der Dinge hängt seiner Meinung nach von diesen Feldern ab. „Jedes natürliche System einer
bestimmten Art besitzt sein eigenes spezifisches Feld“(1) Morphische Felder als Formbildungsursache sind „wie
die bekannten Felder der Physik, nichtmaterielle Kraftzonen, die sich in Raum und Zeit ausbreiten und in der
Zeit andauern. Sie befinden sich innerhalb und in der Umgebung des Systems, welches sie organisieren.“(2)
Als
ich zum ersten Mal die Arbeit „Diamond Field Part I“ von Nico Pachali
im Atelier sah, kam mir Sheldrakes
Überlegungen in den Sinn. Mein Eindruck, hier habe einer auf
bildkünstlerischer Ebene ein verwandtes Gespür
für Formbildungsprozesse im Allgemeinen und ein ähnliches Interesse für
Kräfteverhältnisse und
Konstellationen im Besonderen, besteht bis heute. Wenn Rupert Sheldrake,
vereinfacht gesagt, danach forscht,
was einem Kaninchen seine Kaninchenform gibt, dann geht Nico Pachali der
Frage nach, was eine sich stetig
wandelnde künstlerische Form für Kraftfelder zu erzeugen in der Lage
ist. Felder, die man deutlich
wahrnehmen, aber physikalisch nicht erklären kann, weil vieles von dem,
was wir persönlich erfahren, offenbar
ebenso wie das, was wir unter Bewusstsein verstehen, jenseits
traditioneller naturwissenschaftlicher
Methoden angesiedelt ist. Alles, was man bei der Arbeit „Diamond Field
Part I“ zunächst sieht, ist eine große,
begehbare Fläche aus Papier und Klebeband mit roten Zeichnungen darauf.
Diese mit einem billigen,
kleksenden Kugelschreiber gefertigten Zeichnungen erinnern an
futuristische Flugobjekte oder evozieren ganz
allgemein technoide Assoziationen, die sich sämtlich um das gleiche
Thema zu drehen scheinen, aber letztlich
kaum zu entschlüsseln sind. Angefangen habe alles damit, sagt Nico
Pachali, dass er begonnen habe, sich für
Baseball zu interessieren. „Ein unfassbar langweiliger Sport, wenn man
ihn z.B. im Fernsehen oder Stadion
sieht, wirklich - super langweilig. Eigentlich passiert nichts, außer
immer wieder das Gleiche. ... Irgendwo in
diesen Situationen liegt eine eigenartige Ruhe und Kraft. Irgendetwas
darin ist für mich ein Geheimnis. ... Ich
denke es braucht wesentlich mehr Energie und Ausdauer immer wieder das
Gleiche zu tun, als immer wieder
etwas Neues zu beginnen.“(3) Hinzu kommt, daß die Form des
Baseball-Spielfeldes symmetrisch aufgeteilt ist und
eine Diamantenform aufweist. Die Form des Spielfeldes mit seinen Base-,
Foul- und Grass Linies, mit seinem
Our- und Infield und weiteren Unterteilungen liegt vielen Zeichnungen zu
Grunde. Dass die Bodenarbeit in sich
die Möglichkeit der Wandlung trägt, legen zahlreichen Arbeitsspuren
nahe. Schnitte und Faltspuren deuten
darauf hin, dass hier nicht alles immer so war, wie es nun erscheint und
wahrscheinlich auch nicht so bleiben
wird, wie wir es gerade erleben. Ganz offensichtlich ist neben der
aktuellen Präsenz die Möglichkeit der
Veränderung von zentraler Bedeutung. Und tatsächlich faltet Nico Pachali
die vier Stücke, aus denen das
Gesamtfeld besteht, irgendwann wieder zusammen. So muss bei der
aufgefalteten Fläche immer gleich ihre
aus der Faltung resultierende dreidimensionale Körperform mitgedacht
werden. Denn diese ist eine
gleichberechtigte Variation des substanziell unveränderten Werkes. Man
könnte sagen, es ist dieselbe Arbeit.
Einmal in einem immobilen und dann in einem mobilen Zustand. Zwei sich
bedingende Zustände, wie
Expansion und Kontraktion und wie in gewisser Weise auch die Werke vom
Maillol und Giacometti. In keinem
dieser unterschiedlichen Erscheinungsformen aber werden alle Aspekte
anschaulich. Eine der beiden mit
Zeichnungen bearbeiteten Seite ist in der flächig ausgelegten
Präsentation stets verdeckt und im gefalteten Zustand lässt bestenfalls
ein Zeichnungsfragment einen vagen Rückschluss auf das Ganze zu. Selbst
der Raum,
den die Bodenarbeiten definieren ist nur eine Momentaufnahme und alles
andere als eine stabile Größe. Es ist
das Paradoxon, das hier mitregiert. Denn das Ziel ist offenbar keine
eindeutige Präsentationform, sondern ein
Zustand, der seine potentielle Wandelbarkeit zur Schau stellt. Damit
diese Wandelbarkeit sichtbar werden
kann, muss stets von neuem eine bestimmte Präsentationsform gewählt
werden. Zum Beispiel indem Pachali
den einzelnen, zusammengefalteten Stücken für eine kurze Weile mit
Kreidelinien auf dem Boden einen Ort zu
geben versucht und ihnen so eine Art System oder horizontalen Lagerraum
hinzufügt. Oder indem er aus
Klebeband Folien herstellt, die er benutzt wie einzelne Papierbögen, die
zugeschnitten und wiederum mit
Klebeband zu einer Verpackung der gefalteten Stücke werden. Dabei wird
die jeweilige Form der Verpackung
durch die Größe des zu verpackenden Fragmentes bestimmt. So entstehen
Ummantelungen, die, obwohl nach
praktischen Gesichtspunkten konzipiert, nicht nur Informationen über den
zu verpackenden Inhalt
transportieren, sondern für sich betrachtet wie die Erweiterung des
bisher benutzten Formvokabulars
erscheinen. Und auch diese Hüllen bekommen wieder eine Art imaginäre
Behausung. „Alle Arbeiten habe ich
verpackt in den Atelierraum gelegt und die Stücke für sich allein mit
Kreide umrandet. Im Raum habe ich dann
durch einfache Linien einen zweiten Raum gezeichnet. Ich wollte für mich
zeigen, dass ich im Kopf nicht mit
dem Raum arbeite in dem ich mich physisch befinde, sondern dass ich mit
einem Raum denke, den es real nicht
gibt. Einen Raum, der nur für meine Arbeiten bestimmt ist. ... Ich mag
den Zustand am liebsten, wo alle
Verpackungen entfernt wurden und nur noch die Kreidezeichnungen übrig
bleiben. ... Ich habe das Gefühl, dass
ich zwar immer mit etwas arbeite, aber alles was entsteht soll die
Fähigkeit haben ohne die Arbeit als Arbeit
existieren zu können.“4 Kurz: In welchem Zustand sich uns das „Diamond
Field“ auch gerade zeigt, es verweist
nicht nur auf seine Genese und alle bereits durchgespielten
Präsentationsformen, sondern ist immer auch
schon wieder auf dem Sprung in einen neuen Zustand. Es befindet sich
also permanent in einem Status, der vor
allem die ihm innewohnenden Möglichkeiten zur Schau stellt. „Meine
eigene Arbeit sollte sich im Bestfall
immer in einem reinen Möglichkeitszustand befinden, in dem alles so ist,
wie es in dem Moment ist, aber
eigentlich zur exakt gleichen Zeit auch anders sein könnte.“5
Pachali
frönt geradezu einem Aspekt der
Wahrnehmung, den Robert Musil als „Möglichkeitssinn“ beschrieben hat:
„Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise
nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen;
sondern er erfindet: Hier könnte,
sollte oder müsste geschehen; und wenn man ihm von irgendetwas erklärt,
dass es so sei, wie es sei, dann
denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich
der Möglichkeitssinn geradezu als die
Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und
das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen
als das, was nicht ist. Man sieht, dass die Folgen solcher
schöpferischen Anlage bemerkenswert sein können,
und bedauerlicherweise lassen sie nicht selten das, was die Menschen
bewundern, falsch erscheinen und das,
was sie verbieten, als erlaubt oder wohl auch beides als gleichgültig.
... Wenn man nun in bequemer Weise die
Menschen des Wirklichkeits- und des Möglichkeitssinns voneinander
unterscheiden will, so braucht man bloß
an einen bestimmten Geldbetrag zu denken. Alles, was zum Beispiel
tausend Mark an Möglichkeiten überhaupt
enthalten, enthalten sie doch ohne Zweifel, ob man sie besitzt oder
nicht; ... Es ist die Wirklichkeit, welche die
Möglichkeiten weckt, und nichts wäre so verkehrt, wie das zu leugnen.
Trotzdem werden es in der Summe oder
im Durchschnitt immer die gleichen Möglichkeiten bleiben, die sich
wiederholen, so lange bis ein Mensch
kommt, dem eine wirkliche Sache nicht mehr bedeutet als eine gedachte.
Er ist es, der den neuen
Möglichkeiten erst ihren Sinn und ihre Bestimmung gibt, und er erweckt
sie. Ein solcher Mann ist aber
keineswegs eine sehr eindeutige Angelegenheit. Da seine Ideen, soweit
sie nicht müßige Hirngespinste
bedeuten, nichts als noch nicht geborene Wirklichkeiten sind, hat
natürlich auch er Wirklichkeitssinn; aber es
ist ein Sinn für die mögliche Wirklichkeit und kommt viel langsamer ans
Ziel als der den meisten Menschen
eignende Sinn für ihre wirklichen Möglichkeiten. Er will gleichsam den
Wald, und der andere die Bäume; und
Wald, das ist etwas schwer Ausdrückbares, wogegen Bäume soundso viel
Festmeter bestimmter Qualität bedeuten. Oder vielleicht sagt man es
anders besser, und der Mann mit gewöhnlichem Wirklichkeitssinn gleicht
einem Fisch, der nach der Angel schnappt und die Schnur nicht sieht,
während der Mann mit jenem
Wirklichkeitssinn, den man auch Möglichkeitssinn nennen kann, eine
Schnur durchs Wasser zieht und keine
Ahnung hat, ob ein Köder daran sitzt.“6 Worauf das hinausläuft? Wir
wissen es nicht. Möglicherweise wird sich
alles immer weiter verwandeln und noch viel komplexer werden.
Möglicherweise springt die ganze Sache auch
auf eine höhere Ebene und transformiert sich selbst in etwas völlig
Neues. Diejenigen, die nicht an simplen
Kausalitäten interessiert waren, sondern an der Verwandlung eines
komplexen Zustandes in einen anderen,
nannte man im Mittelalter und der Renaissance Magier. Ein Magier oder
Magus verwandelte. Seine
selbstgestellte Aufgabe bestand darin, den Übergang von einem niedrigen
zu einem höheren, edleren Zustand
zu bewerkstelligen. Bereits im 13. Jahrhundert lehnte Albertus Magnus
die simple Kausalität, also den
Gedanken „A verursacht B“, ab. Er ging vielmehr davon aus, dass nur eine
Konfiguration eine andere
Konfiguration zu schaffen in der Lage ist. Denn, so schrieb er, es sei
ja nicht so, dass Teile des Universums
andere Teile verursachen sich so oder so zu verhalten. Es sind vielmehr
die Konfigurationen aller Dinge im
Universum, die die Voraussetzung bilden, damit eine andere Konfiguration
entstehen kann. Das sich stetig
transformierende Werk lässt vermuten, dass für Nico Pachali die
Wechselwirkung komplexer Konfigurationen
viel sinnstiftender ist, als die Funktionalität überschaubarer
Kausalitätsgesetze. Doch das ganz und gar
Erstaunliche ist vielleicht, dass man bei diesem Werk nicht mehr klar
zwischen Hard und Software
unterscheiden kann. Für gewöhnlich bezeichnen wir die Empfindungen als
Software, während die Zeichnung,
das Bild, die Skulptur der Hardware gleicht. Hier nun sind beide derart
ineinander verwoben, dass eine
Unterscheidung schwerfällt. Denn das, was wir erfahren, erscheint mir
viel beständiger und stabiler als das,
was wir das „Materielle“ nennen und mit harten Fakten assoziieren.
Vielleicht ist Nico Pachali ja auf dem Weg,
jener Künstler zu werden, dem schließlich, wie es Robert Musil
beschrieben hat, „eine wirkliche Sache nicht
mehr bedeutet, als eine gedachte.
Andreas Bee, 2018
1 Rupert Sheldrake, Das Gedächtnis der Natur, München 1988, S. 11
2 Morphische Felder sind also „potentielle Organisationsmuster“.Sheldrakes Hypothese wurde in der
Naturwissenschaft nach anfänglichem Interesse im Wesentlichen ignoriert und wird bis heute überwiegend als
pseudowissenschaftlich angesehen. Einige renommierte Quantenphysiker allerdings, darunter David Bohm und
Hans-Peter Dürr, haben für eine ernsthafte Untersuchung dieser Hypothese plädiert.
3 Nico Pachali im Katalog „infield shift“, Selbstverlag 2017
4 Nico Pachali, Fictional Studies I: Diamond Field to Isolated Building // Artist Talk Between Me and Nico
Oachali, 2018, erschienen anläßlich der Meisterschülergespräche vom 22./23.1.2018 an der HBK Braunschweig.
5 ebenda